Die Erforschung Seltener Erkrankungen braucht Ausdauer und Leidenschaft: Die Neurologin Prof. Dr. Rebecca Schüle über Beruf und Berufung, Erfolg und Misserfolg und über das, was sie als Ärztin von ihren Patientinnen und Patienten gelernt hat.

Prof. Dr. Rebecca Schüle erforscht Hereditäre Spastische Spinalparalysen – eine durch einen seltenen Gendefekt ausgelöste, langsam fortschreitende Gangstörung.
Ingo Rappers / Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH)
Nicht aufgeben, von Neuem anfangen, vermeintliche Fehlschläge zunächst zur Seite legen, kleine Schritte als wichtige Erfolge verbuchen – das prägt den klinischen und wissenschaftlichen Alltag von Rebecca Schüle. Die Neurologin am Hertie Institut für klinische Hirnforschung der Universitätsmedizin Tübingen erforscht die Krankheit Hereditäre Spastische Spinalparalysen, kurz HSP, die zu den Seltenen Erkrankungen zählt. Von ihnen sind laut Definition nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen betroffen. „Als Behandelnde und Forschende müssen wir Fachleute für Spezialfälle sein“, betont Schüle, „jede einzelne Patientin und jeder einzelne Patient hat besondere Nöte und Sorgen“.
Hereditäre Spastische Spinalparalysen bezeichnen eine langsam fortschreitende Gangstörung. Durch einen Gendefekt werden motorische Impulse vom Gehirn bei den Betroffenen nur unvollständig oder gar nicht über das Rückenmark weitergeleitet; viele Erkrankte leiden unter steifen Beinen und häufigem Stolpern oder sind sogar ganz auf einen Rollstuhl angewiesen. In Deutschland sind circa 6.000 bis 8.000 Menschen von HSP in unterschiedlichen Erscheinungsformen betroffen.
Das Besondere an der Krankheit: Bei manchen treten kurz nach der Geburt erste Symptome auf, bei anderen macht sich die Krankheit erst im hohen Alter bemerkbar. „Aktuell sind weit über hundert genetisch definierte Subtypen der Erkrankung bekannt. Gemeinsam ist ihnen, dass die Symptome teilweise mit Medikamenten, Physiotherapie oder rehabilitativen Maßnahmen behandelbar sind, aber sie sind eben nicht heilbar und die zunehmende Verschlechterung der Erkrankung kann nicht dauerhaft aufgehalten werden“, beschreibt Rebecca Schüle die Herausforderung ihres Forschungsfeldes.
Was zählt, sind die kleinen Erfolge und gebündelte Expertise
Nicht selten kommen ganze Familien in die HSP-Ambulanz der Tübinger Universitätsklinik, denen die Leitende Oberärztin mitteilen muss, dass niemand in Deutschland und auch weltweit nur wenige andere Menschen diese besondere Form der HSP haben. Oft haben die Betroffenen eine jahrelange Odyssee hinter sich, bis die richtige Diagnose gestellt werden kann: „Auch viele Ärztinnen und Ärzte wissen wenig über die Krankheit, weil sie so selten ist, und häufig wird eine falsche Diagnose gestellt, weil HSP Symptome aufweist, die auch für Erkrankungen wie beispielsweise Multiple Sklerose zutreffen“, berichtet die Neurologin. Noch lässt sich zudem nicht immer genau das Gen identifizieren, das Auslöser der Krankheit sein könnte.
„Je besser wir den jeweiligen Gendefekt verstehen, der zu einer bestimmten Störung in der Zelle führt, desto eher können wir auch Therapien finden, die diesen Defekt wieder korrigieren“, sagt Schüle. „In der Forschung hat sich zwar schon viel getan, aber noch immer können wir leider nicht jeder Patientin oder jedem Patienten eine spezifische Therapie anbieten.“ Genetische Ursachenforschung ist deshalb letztendlich auch Therapieforschung, bei der nicht der eine große Durchbruch erwartbar ist – wie bei anderen Seltenen Erkrankungen auch gleichen die Arbeiten zu HSP vielmehr einem Puzzle, das Stück für Stück zusammengefügt werden muss.
Umso wichtiger ist Rebecca Schüle deshalb das von ihr koordinierte Netzwerk TreatHSP, das Expertise und Ressourcen bündelt: „Gerade bei den Seltenen Erkrankungen ist eine gute Vernetzung immens wichtig. Das Netzwerk gibt uns die Chance, HSP bei Betroffenen, aber auch in der Fachwelt bekannter zu machen, Ärztinnen und Ärzte, Betroffene und Forschende in einen breiten Austausch zu bringen und so Forschung zu koordinieren und auf gemeinsame Ziele auszurichten.“
Das Netzwerk TreatHSP widmet sich der Erforschung Hereditärer Spastischer Spinalparalysen (HSP), einer seltenen erblichen Nervenerkrankung, die zu einer langsam fortschreitenden Lähmung der Beine und Gangstörung führt. In enger Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) bündelt das Netzwerk die deutschlandweite Expertise und arbeitet an neuen Behandlungsoptionen. Das Bundesministerium für Bildung Forschung (BMBF) fördert den Forschungsverbund bis Ende 2022 mit 2,4 Millionen Euro.
Mehr Infos unter www.treathsp.net
Patientinnen und Patienten als Partner der Forschung
An der HSP-Ambulanz in Tübingen, die Schüle gemeinsam mit Professor Dr. Ludger Schöls leitet, verbindet sich Wissenschaft mit medizinischer Versorgung: „Wir versuchen konsequent, unsere Forschungsergebnisse in neue Therapieoptionen umzusetzen. Außerdem arbeiten wir in klinischen Studien daran, für häufige Krankheiten entwickelte Therapieansätze für Seltene Erkrankungen anwendbar zu machen“, erläutert Schüle.
Unverzichtbare Partner dabei sind die Patientinnen und Patienten selbst: Sie geben beispielsweise wichtiges Feedback, welche Forschungsfragestellungen besonders relevant für sie sind, welche Symptome durch eine Therapie adressiert werden sollten oder wie gut bestimmte Therapieverfahren bei ihnen wirken. Welche Art von Krankengymnastik hilft, wie häufig und lange sollten die Übungen erfolgen, wie intensiv und wie schonend? „Das kann im Alltag von Betroffenen den entscheidenden Unterschied ausmachen und ist trotz all unserer Erfahrung eine Perspektive, die uns fehlt“, beschreibt Schüle.
Auch international wird der Tübinger Forschungsansatz seit Bestehen des Netzwerks aufmerksam verfolgt: Gerade erst haben australische Forschende ein gemeinsam mit Patientinnen und Patienten entwickeltes Physiotherapie-Programm ins Englische übersetzt und damit für HSP-Erkrankte weltweit zugänglich gemacht.
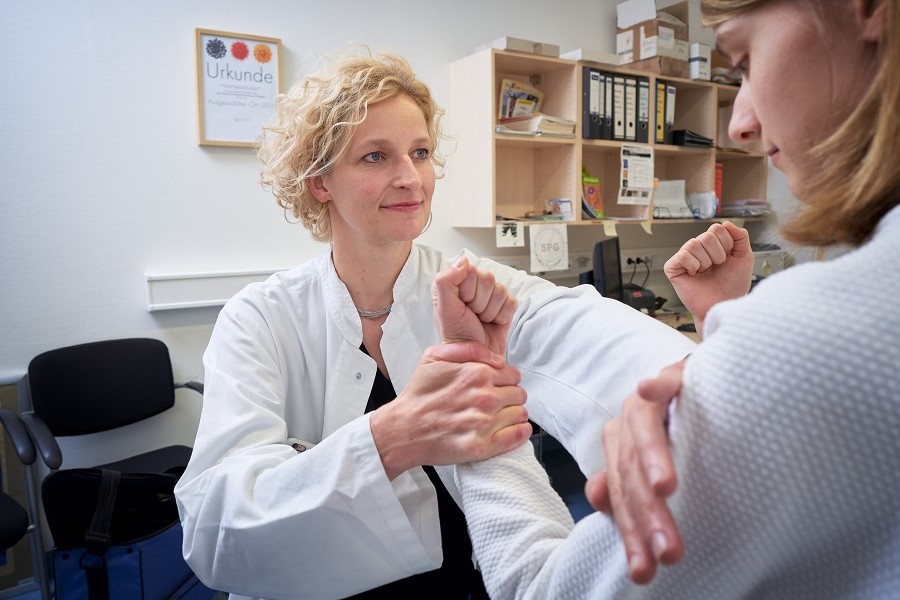
Das Ziel, neue Therapiemöglichkeiten für ihre Patientinnen und Patienten zu finden, für Rebecca Schüle „der stärkste Antrieb, den es geben kann“.
Ingo Rappers / Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH)
Gelungene Kombination von Klinik und Wissenschaft
Grenzen kennen Rebecca Schüle und ihr Team dennoch: „Wer in diesem Bereich arbeitet, stößt im Alltag ständig auf Grenzen, auf Dinge, die noch unbekannt sind und noch nicht behandelt werden können“. Davon lässt sich die Forscherin nicht frustrieren – sie arbeitet lieber aktiv daran, „jede neu auftauchende Grenze ein klein wenig zu verschieben“. Dies als Ärztin tun zu wollen, wurde ihr schon in jungen Jahren klar – sie wuchs im Hohenlohekreis nördlich von Schwäbisch-Hall auf, wo ihr Vater ein Heim für Menschen mit Behinderung leitete. „Unser Haus lag auf dem Gelände. So habe ich schon als kleines Kind die Erfahrung gemacht, dass viele meiner Freunde und Spielkameraden besondere Herausforderungen zu bewältigen hatten“, berichtet die Neurologin.
Zur Wissenschaftlerin wurde Rebecca Schüle dann aufgrund ihres Studiums in Heidelberg und ihres Interesses an der Genetik: „Ich bin ein sehr neugieriger und lösungsorientierter Mensch, die Kombination aus Klinik und Forschung ist für mich genau das Richtige, denn die Klinik verankert mich gleichzeitig in der Forschung.“ Das Ziel, neue Therapiemöglichkeiten für ihre Patientinnen und Patienten zu finden, „ist für mich der stärkste Antrieb, den es geben kann“, unterstreicht Schüle.
Ansporn gibt Schüle aber auch die von ihr geleitete Arbeitsgruppe: „Menschen aus aller Welt für ein Nischenthema wie die HSP zu begeistern, von denen jeder einen eigenen Schatz an Ideen, Wissen und unterschiedliche Erfahrungen mitbringt, ihnen ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie wachsen und vorankommen können – das ist das, was mich erfüllt und bei vermeintlichen Misserfolgen stützt, ohne die es keine erfolgreiche Forschung geben kann.“
Der idealen Forscherwelt kommt ihre Arbeit am Hertie Institut für klinische Forschung damit schon ziemlich nahe; den Wissenschaftsbetrieb erlebt Schüle dennoch als Feld, dem es zuweilen an Ausgewogenheit fehle. Universitäre Forschung, ist Rebecca Schüle überzeugt, braucht Vielfalt: Sie braucht die Visionäre und Methodenspezialisten, die hervorragende Laborarbeit leisten, die arrivierten Führungskräfte und die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen. „Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es in zehn Jahren völlig selbstverständlich ist, mehr Frauen in Führungsgremien anzutreffen“, ergänzt sie.
Im Alltag abseits der Forschung bestimmen andere das Tempo
Fehlschläge begreift Rebecca Schüle eher als Motivation für einen erneuten Versuch; Dinge, die sie nicht in der Hand hat, kann sie zur Seite legen: „So gesehen sind meine Patientinnen und Patienten meine besten Lehrer, auch sie haben lernen müssen, ihre Erkrankung hinzunehmen und selbst etwas zu tun, das ihren Alltag erleichtert“.
Wie dies einer vielbeschäftigten Wissenschaftlerin gelingt? Beim Sport findet sie Ausgleich und Gelegenheit zum Abschalten, als Cellistin in einem kleinen Orchester zum Tanz aufzuspielen ist ein zuletzt „leider viel zu selten“ praktiziertes Hobby. Die Mutter zweier inzwischen erwachsener Söhne hat die Langsamkeit für sich entdeckt und ist in der Corona-Pandemie zur Bienenzüchterin und Sauerteig-Bäckerin geworden: „Backen und Imkern hilft mir, zu entschleunigen. Bei beidem bestimmen andere das Tempo, auch wenn man es selbst vielleicht gern etwas schneller hätte.“