Allein in Deutschland erhalten jedes Jahr rund 3.000 Menschen eine Transplantation fremder Stammzellen. Nach dem Eingriff kann es jedoch zu schweren Komplikationen kommen. Neue Computermodelle könnten die Überlebenschancen deutlich erhöhen.
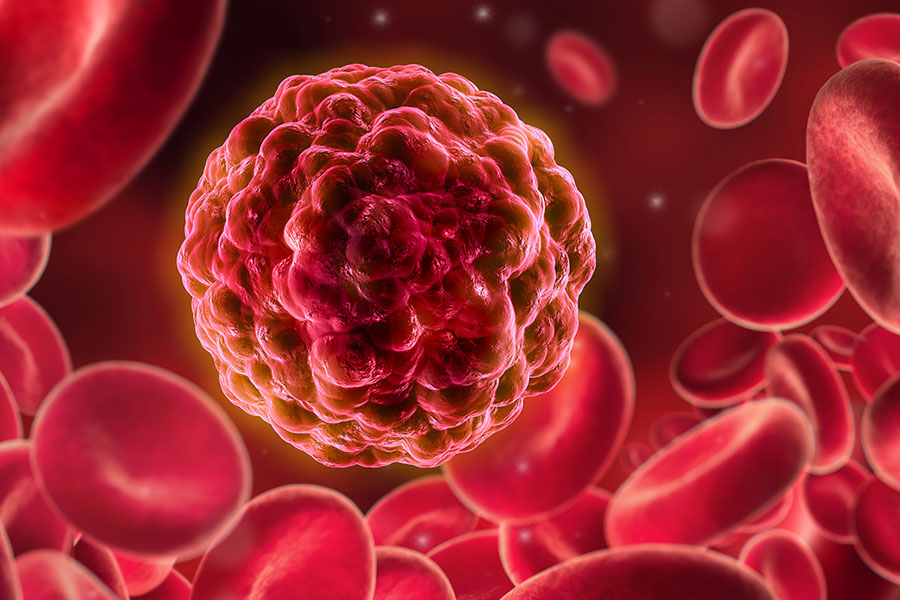
Künstliche Intelligenz unterstützt den Kampf gegen Blutkrebs: Das Forschungsteam um Stephan Kiefer entwickelt ein computergestütztes Frühwarnsystem, das anzeigt, ob nach einer Stammzelltransplantation mit Komplikationen zu rechnen ist.
peterschreiber.media/Adobe Stock
Eine Stammzellspende ist für viele Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs oder Lymphdrüsenkrebs die Hoffnung auf ein zweites Leben. Nach einer erfolglosen Strahlen- oder Chemotherapie gibt es für sie oftmals keine andere Chance auf Heilung. Doch Stammzelltransplantationen bergen hohe Risiken für Komplikationen und Rückfälle. Zur Einschätzung der individuellen Risiken müssen sich Ärztinnen und Ärzte bislang überwiegend auf Erfahrungswerte stützen. Ein Forschungsteam unter der Federführung des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik entwickelt ein computergestütztes Frühwarnsystem, das die Risikoeinschätzung schneller und besser machen soll. Das Bundesforschungsministerium unterstützt das Projekt „XplOit“ im Rahmen der Fördermaßnahme „i:DSem – Integrative Datensemantik in der Systemmedizin“. „Unser Ziel ist es, die Überlebensrate der Patientinnen und Patienten zu erhöhen und Komplikationen früher zu erkennen“, sagt Informatiker Stephan Kiefer.
Damit die Stammzelltransplantation gelingt, muss zuvor das kranke Immunsystem der Patientinnen und Patienten zerstört werden. Aggressive Strahlen- oder Chemotherapien töten hierfür die blutbildenden Zellen der Patienten ab, die vom Krebs befallen sind. Erst durch eine Transplantation fremder Blutstammzellen kann der Körper anschließend wieder neues Blut bilden. Dabei wird jedoch auch das Immunsystem der Spenderin oder des Spenders übertragen, was zu schweren Komplikationen führen kann. „Das neue Immunsystem hat ein anderes Leben hinter sich als das eigene. So können etwa Virusinfektionen, die der Körper vorher erfolgreich in Schach gehalten hat, plötzlich wieder ausbrechen“, erklärt Kiefer. Die größte Gefahr besteht jedoch darin, dass das neue Immunsystem den Körper der Patientinnen und Patienten angreift. Wenn die Medizinerinnen und Mediziner nicht rechtzeitig eingreifen, kann es zu lebensgefährlichen Folgen kommen.
Digitale oder elektronische Patientenakten (ePA) speichern alle wichtigen Daten einer Patientin oder eines Patienten – von Diagnosen und Therapien bis hin zu Medikamentenunverträglichkeiten und Notfalldaten. Die ePA kann es allen Behandelnden – ob in der Praxis oder in der Klinik – ermöglichen, diese medizinischen Daten „per Mausklick“ einzusehen. So könnten Ärztinnen und Ärzte Doppeluntersuchungen vermeiden und ihre Patientinnen und Patienten schneller passgenau behandeln.
Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch technische Systeme, deren Leistungen den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen ähneln. KI ist demnach, wenn Computer mithilfe programmierter oder erlernter Zusammenhänge Daten analysieren und Aufgaben selbstständig lösen. Eine verbindliche wissenschaftliche Definition von KI gibt es jedoch nicht. Maschinelles Lernen ist eine grundlegende Methode der KI, das Deep Learning wiederum ein Verfahren des Maschinellen Lernens.
Frühwarnsystem für Komplikationen
Hier setzt das Projekt an. Das Forschungsteam entwickelt mithilfe von Künstlicher Intelligenz ein Frühwarnsystem, das anzeigt, ob mit Komplikationen zu rechnen ist. Bilden die neuen Zellen kein Blut? Kommt der Krebs zurück? Greift das fremde Immunsystem den Körper an? Eine Art Ampelsystem soll zukünftig hierfür individuelle Vorhersagen liefern. So könnten die Ärztinnen und Ärzte bei drohenden Komplikationen früher eingreifen und gegensteuern. In der Praxis könnte das so aussehen: Die Vorhersage-Instrumente sind mit der digitalen Patientenakte gekoppelt, in der alle wichtigen Daten des Betroffenen und dessen Krankheitsverlauf engmaschig erfasst werden. „Solange das Ampelsystem auf ,Grün‘ steht, weiß der behandelnde Arzt, dass der Patient stabil ist“, erklärt Kiefer. „Bei verdächtigen Ergebnissen dagegen würde das Ampelsystem sofort auf ‚Gelb‘ oder ‚Rot‘ springen.“
Um die Computermodelle zu trainieren, haben die Forscherinnen und Forscher sie mit einer großen Datenmenge gefüttert. Hierfür mussten sie zunächst die Gesundheitsdaten von mehr als 1.500 Patientinnen und Patienten sammeln und vereinheitlichen. Dabei konnten sie auf die Daten der beteiligten Transplantationszentren des Universitätsklinikums Essen und des Universitätsklinikums des Saarlandes zugreifen. „Das war eine Mammut-Aufgabe, denn selbst diese beiden Krankenhäuser haben verschiedene IT-Systeme“, sagt Kiefer. „Neben klassischen Labordaten nutzen wir auch klinische Parameter wie Diagnosen und Medikamentenverordnungen in unseren Modellen. Dafür verwenden wir vielfältige Datenquellen wie Tabellen oder sogar ganze Arztbriefe.“ Zur Auswertung und Entwicklung der Modelle wurden die Daten der Patientinnen und Patienten pseudonymisiert.
Semantische Technologien – Grundlage für die computergestützte Datenverarbeitung
Klinik und Forschung produzieren immer mehr Wissen – doch nur einen kleinen Teil davon können Ärztinnen und Ärzte sowie Forschende für eine computergestützte Weiterverarbeitung nutzen. Dies betrifft nicht nur die Daten aus klinischen oder experimentellen Messungen, sondern auch die Informationen aus Fachpublikationen oder klinischen Berichten. Damit werden die ursprünglichen Vorteile der Informationszuwächse für die Systemmedizin aufgehoben. Ein Lösungsweg aus dieser Situation liegt darin, die Daten künftig so aufzubereiten, dass die Dateninhalte wesentlich stärker als bisher computergestützt und dadurch effektiver ausgewertet werden können. Hierfür sind sogenannte semantische Technologien notwendig, deren Entwicklung im Zentrum der Fördermaßnahme „i:DSem – Integrative Datensemantik in der Systemmedizin“ steht. Bis 2021 wird das BMBF dafür mehr als 20 Millionen Euro bereitstellen.
„Hoffnung auf ein digital vernetztes Gesundheitssystem“
Bevor das Frühwarnsystem in Kliniken eingesetzt wird, muss es noch den Praxistest bestehen. Im nächsten Schritt wollen die Forscherinnen und Forscher daher zeigen, ob ihre Computermodelle dem Vergleich mit den Entscheidungen der Mediziner standhalten. „Es muss auf jeden Fall ein Mehrwert für den Patienten bestehen“, sagt Kiefer. „Unsere Vorhersage-Instrumente sollen letztendlich bessere Prognosen, auch über einen längeren Zeitraum hinweg, liefern.“ Für einen flächendeckenden Einsatz müsste das Tool jedoch nach jetzigem Stand an jedes einzelne Krankenhaus-IT-System individuell angepasst werden. „Wir hoffen daher auf die zunehmende digitale Vernetzung des Gesundheitssystems, wie sie zum Beispiel in der Medizininformatik-Initiative des Bundesforschungsministeriums vorangetrieben wird.“
ist die Wissenschaft der systematischen Erschließung, Verwaltung, Aufbewahrung, Verarbeitung und Bereitstellung von Daten, Informationen und Wissen in der Medizin und im Gesundheitswesen. Die wissenschaftliche Analyse der vernetzten Daten aus Klinik und Forschung soll helfen, Krankheiten besser zu verstehen, sie gezielter zu behandeln und ihnen wirkungsvoller vorzubeugen. Um das Potenzial der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu nutzen, hat die Medizininformatik eine hohe Bedeutung.

Ob ein Mensch erkrankt oder nicht, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Aufgabe der Systemmedizin ist es, das komplexe Zusammenspiel dieser Faktoren umfassend und mithilfe von computergestützten Analysen zu entschlüsseln. Dafür arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Lebenswissenschaften und der klinischen Forschung, der Informatik und der Mathematik eng zusammen. Ihre Erkenntnisse bereiten den Weg für frühere Diagnosen, präzisere Therapien und eine wirkungsvollere Vorbeugung.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem durch das Forschungs- und Förderkonzept „e:Med – Maßnahmen zur Etablierung der Systemmedizin“. Seit Ende 2012 stellt das Forschungsministerium dafür – zunächst für acht Jahre – 200 Millionen Euro bereit.
Ansprechpartner:
Dipl.-Informatiker Stephan Kiefer
Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik IBMT
Joseph-von-Fraunhofer-Weg 1
66280 Sulzbach/Saar
stephan.kiefer@ibmt.fraunhofer.de