Zur Verbesserung der örtlichen Gesundheitssysteme und Bekämpfung lokaler Krankheiten brauchen die Ärmsten der Welt die Solidarität der Industrienationen. Die Bundesregierung engagiert sich grenzüberschreitend – auf europäischer und globaler Ebene.

Um die Versorgung zu verbessern, werden die Gesundheitssysteme vor Ort gestärkt.
Alexandra Longuet
Nur zum Teil ist die besondere Problemlage der Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf fehlende oder nur begrenzt wirksame Arzneimittel und Impfstoffe zurückzuführen. Beispielsweise ist Malaria nicht nur wegen der fehlenden Verfügbarkeit von Arzneimitteln eine der weltweit bedrohlichsten Infektionskrankheiten, sondern auch, weil schnelle und sichere Diagnosemöglichkeiten vor Ort häufig fehlen. Zudem erfolgt die Behandlung teilweise falsch oder zu spät und können sich Patientinnen und Patienten die Behandlung oft nicht leisten. Zum Beispiel fordert die in Europa bereits erfolgreich bekämpfte Tollwut jährlich noch etwa 60.000 Tote weltweit, insbesondere in unterversorgten Regionen in Afrika und Asien. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt nicht gewinnorientierte Produktentwicklungspartnerschaften (PDPs), die sich diesen Herausforderungen explizit stellen. Hier arbeiten öffentliche und privatwirtschaftliche Akteure zusammen, um effektive Präventionsmaßnahmen, Therapien und Diagnostika zu entwickeln, zu denen die Menschen vor Ort Zugang erhalten sollen.
Eine gezielte Krankheitsbekämpfung kann zudem nur durch systematische Untersuchungen zur Wirksamkeit von Maßnahmen unter realen Bedingungen erfolgreich sein. Die vom BMBF geförderten „Forschungsnetzwerke für Gesundheitsinnovationen in Subsahara-Afrika“ und die europäisch-afrikanische Forschungsförderinitiative „European and Developing Countries Clinical Trials Partnership“ (Global Health EDCTP3) setzen hier an. Sie stärken nicht nur die Forschungssysteme der afrikanischen Partnerländer, sondern sie haben zusätzlich positive Effekte auf die Gesundheitsversorgung und die Ausbildung von Forscherinnen und Forschern, den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie Gesundheitspersonal vor Ort.
Nationale Forschungslandschaft stärken und vernetzen
Das BMBF stärkt die nationale Forschungsszene auf dem Gebiet der vernachlässigten und armutsassoziierten Erkrankungen in Deutschland und vernetzt die relevanten Akteure. Dabei setzt es neben der Projektförderung auch auf die Finanzierung von Forschungseinrichtungen. 2019 hat das BMBF die Förderung der „German Alliance for Global Health Research (GLOHRA)“ initiiert, um die interdisziplinäre Forschung zur Globalen Gesundheit in Deutschland zu stärken. Zweck der Fördermaßnahme ist der Aufbau eines wissenschaftsgetriebenen Forums für die deutsche Forschungsszene im Bereich der Globalen Gesundheit sowie die verbesserte standort- und disziplinübergreifende Vernetzung und Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Disziplinen der Globalen Gesundheit.
Mit der Projektförderung initiiert das Bundesforschungsministerium darüber hinaus neue Maßnahmen in Bereichen mit hohem Forschungsbedarf. Sie sollen die nationale Forschungslandschaft zu Infektionskrankheiten und den vernachlässigten und armutsassoziierten Krankheiten ausbauen. Dazu zählt die Förderung talentierter Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Seit 2020 werden „Nachwuchsgruppen in der Infektionsforschung“ gefördert mit dem Ziel, die wissenschaftliche Basis in Deutschland zu stärken.
RHISSA – Forschungsnetzwerke für Gesundheitsinnovationen in Subsahara-Afrika

Die Gesundheitssituation der Menschen in Subsahara-Afrika verbessern – zu diesem Ziel trägt der Ausbau von Forschungskapazitäten vor Ort bei, der durch eine enge afrikanisch-deutsche Zusammenarbeit in der Gesundheitsforschung erreicht werden soll. Eine zentrale Maßnahme dieser Kooperation sind die „Forschungsnetzwerke für Gesundheitsinnovationen in Subsahara-Afrika“, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seit 2016 mit insgesamt rund 100 Millionen Euro fördert.
Im Fokus der afrikanischen und deutschen Forschenden stehen Krankheiten, die in Subsahara-Afrika eine hohe Krankheitslast verursachen, wie z. B. Tuberkulose, Sepsis und vernachlässigte Tropenkrankheiten. Aber auch nichtinfektiöse Krankheiten mit hoher epidemiologischer Relevanz wie Krebs werden prioritär erforscht. Mit ihrer Arbeit tragen sie dazu bei, Erkrankungen besser zu verstehen und ihre Diagnose und Therapie zu optimieren. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Verbesserung der Jugendgesundheit in den Blick genommen. Durch den Ausbau von Labor- und Klinik-Kapazitäten in den Partnerländern eröffnen sich Forschenden sowie Ärztinnen und Ärzten zudem attraktive Karriereoptionen.
In der ersten im Jahr 2016 gestarteten Förderphase haben fünf afrikanisch-deutsche Netzwerke unter afrikanischer Koordination und deutscher Co-Koordination bedeutende Ergebnisse erzielt. Hierzu zählen beispielsweise neue WHO-Leitlinien, SARS-CoV-2-Sequenzierungen und die Ausbildung von mehr als 130 jungen Forscherinnen und Forschern. Deshalb hat das BMBF seit Anfang 2023 unter dem Akronym RHISSA („Research Networks for Health Innovations in Sub-Saharan Africa“) eine zweite Förderphase gestartet, um die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Ländern Subsahara-Afrikas weiter zu stärken. Neben exzellenter Implementierungsforschung sind der Auf- und Ausbau von Forschungskapazitäten sowie eine bessere Nord-/Süd- und Süd-/Süd-Vernetzung wesentliche Aufgaben der geförderten Netzwerke. Ein Schlüssel für die erfolgreiche Translation erzielter Innovationen in die Politik und Praxis und die Nachhaltigkeit der Maßnahme ist die enge Zusammenarbeit der Forschungsnetzwrke mit den Regierungen ihrer Partnerländer sowie mit lokalen Universitäten und Gesundheitseinrichtungen.
In der bis zum Jahr 2028 laufenden zweiten Förderphase unterstützt das BMBF sechs Forschungsnetzwerke, an denen 36 Forschungspartner aus 13 Ländern Subsahara-Afrikas und 12 Forschungspartner aus Deutschland beteiligt sind.
Eine Übersicht zu den wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachtern der zweiten Förderphase befindet sich hier.
Mehr zur RHISSA Bridging-Konferenz zum Auftakt der zweiten Förderphase lesen Sie hier: Gesundheit in Afrika dank gemeinsamer Forschung verbessern

2023-2028 (2. Förderphase)
Direktor
Prof. Dr. Damalie Nakanjako
Makerere University, College of Health Sciences, Kampala, Uganda
Co-Direktor
Prof. Dr. Uwe Truyen
Universität Leipzig, Leipzig, Deutschland
Partnerinstitutionen (alphabetisch nach Ländern)
Institutionen vor Ort haben seit langem bewiesen, dass sie in der Lage sind, Ausbrüche übertragbarer Krankheiten zu erkennen und zu bekämpfen, doch bleiben die Prävention und das Management solcher Krankheiten eine große Herausforderung in Afrika südlich der Sahara. Dies gilt insbesondere für vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs), NTD-Koinfektionen und antimikrobielle Resistenzen (AMR), die viele gängige Antibiotika unwirksam machen. Solche Resistenzen stellen weltweit eine zunehmende Gesundheitsbedrohung dar – insbesondere in Subsahara-Afrika, das die höchste AMR-Belastung der Welt aufweist. Um AMR zu verstehen und zu bekämpfen, gilt es die Zusammenhänge und die Übertragung zwischen Mensch, Tier und Umwelt zu betrachten. Ziel des ADAPT-Netzwerks ist es, in sechs afrikanischen Ländern südlich der Sahara – in Partnerschaft mit staatlichen, lokalen und regionalen Akteuren – Kapazitäten zur Verbesserung des Managements von AMR und NTDs sowie des Umgangs mit Antimikrobiotika unter Anwendung eines One Health-Ansatzes aufzubauen.
Faktenblatt in englischer Sprache
Weitere Informationen:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/adapt-one-health-network/

2016-2023 (1. Förderphase)
Direktorin
Prof. Dr. Chantal Akoua-Koffi
University Teaching Hospital, University of Bouaké, Bouake, Côte d’Ivoire
Co-Direktorin
Dr. Grit Schubert (Vorgänger Prof. Dr. Fabian Leendertz)
Robert Koch-Institut, Berlin, Deutschland
Partnerinstitutionen (alphabetisch nach Ländern)
Das ANDEMIA-Netzwerk widmet sich der Diagnose und Bekämpfung von akuten Infektionskrankheiten der Atemwege und des Magen-Darm-Trakts, akutem Fieber unbekannter Herkunft und Infektionen mit multiresistenten Bakterien in Subsahara-Afrika. Forschungsteams aus Côte d'Ivoire, Burkina Faso, der Demokratischen Republik Kongo und Südafrika arbeiten mit dem Robert Koch-Institut in Deutschland zusammen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Betroffene Krankenhauspatienten und -patientinnen in Subsahara-Afrika profitieren so von einer besseren Labordiagnostik und Schulungen des Klinikpersonals, die helfen sollen, die Verbreitung von Krankheitserregern in Gesundheitseinrichtungen zu verhindern. Darüber hinaus liefern die gesammelten Daten wichtige Informationen über die Verbreitung und Übertragungsmuster von Krankheitserregern sowohl in Subsahara-Afrika als auch auf globaler Ebene. Ausbildungsprogramme für Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen sorgen für eine nachhaltige Weitergabe der Kenntnisse in den Partnerländern.
Faktenblatt in englischer Sprache
Weitere Informationen: www.andemia.org

2016-2023 (1. Förderphase)
Direktorin
Prof. Dr. Harriet Mayanja-Kizza
Makerere University, Kampala, Uganda
Co-Direktorin
Prof. Dr. Eva Rehfuess
Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland
Partnerinstitutionen (alphabetisch nach Ländern)
Das übergeordnete Ziel von CEBHA+ war der Aufbau langfristiger Kapazitäten und Infrastrukturen für die evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (EBHC) und die öffentliche Gesundheit in Subsahara-Afrika, insbesondere in Äthiopien, Malawi, Ruanda, Südafrika und Uganda. Das Konsortium führte Primärforschung und Evidenzsynthesen zur Vorbeugung und Behandlung nicht übertragbarer Krankheiten, insbesondere Diabetes und Bluthochdruck, sowie zur Prävention von Verkehrsunfällen durch. Die Ergebnisse wurden in mehr als 30 Fachpublikationen und auf nationalen und internationalen Konferenzen präsentiert. Ein entscheidender Teil der Arbeit von CEBHA+ war die Anwendung eines integrierten Ansatzes zum Wissenstransfer (IKT), um die Übernahme der Erkenntnisse in Politik und Praxis zu fördern. Dazu gehörte die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte im Rahmen einer Prioritätensetzung mit politischen Entscheidungsträgern und die kontinuierliche systematische und ad-hoc Einbindung der wichtigsten Interessenvertreter während des gesamten Forschungsprozesses. Die CEBHA+-Partner erstellten über 20 issue briefs, um die Forschungsergebnisse zu vermitteln und vorrangige Maßnahmen zu empfehlen. Eine weitere wichtige Aufgabe von CEBHA+ war der Aufbau von Kapazitäten bei Studierenden, Forschenden und Entscheidungsträgern auf individueller, institutioneller und systemischer Ebene. In den einzelnen Ländern wurden u. a. Workshops zu evidenzbasierter öffentlicher Gesundheit, systematischen Übersichtsarbeiten, der Vermittlung von EBHC und IKT durchgeführt. CEBHA+ vergab zudem Stipendien an sieben Masterstudierende, elf Doktoranden und zwei Postdocs.
Faktenblatt in englischer Sprache
Weitere Informationen: www.cebha-plus.org
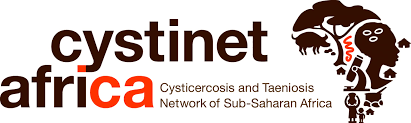
2016-2023 (1. Förderphase)
Direktor
Prof. Helena Ngowi
Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tansania
Co-Direktor
Prof. Dr. Dr. Andrea Winkler
Technische Universität München, München, Deutschland
Partnerinstitutionen (alphabetisch nach Ländern)
Aus dem CYSTINET-Afrika Netzwerk ist eine One Health-Plattform hervorgegangen, die zur Bekämpfung der durch Bandwürmer ausgelösten Erkrankung Taenia solium (Neuro-) Zystizerkose/Taeniose (TSCT) beiträgt. Die Zystizerkose zählt zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten und verbreitet sich trotz existierender Behandlungsmöglichkeiten zunehmend in weiten Teilen Subsahara-Afrikas. Bei Parasitenbefall des Gehirns entwickelt sich die Neurozystizerkose, die die häufigste Ursache für Epilepsien in Subsahara-Afrika ist. Die Erkrankung betrifft gleichermaßen menschliche wie tierische Gesundheit und führt in den betroffenen ländlichen Gebieten auch zu hohen wirtschaftlichen Verlusten.
Deshalb verfolgt CYSTINET-Afrika das One-Health Konzept, d. h. die gleichzeitige Beachtung und Berücksichtigung human- und veterinärmedizinischer Aspekte. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts ist die Entwicklung von Aufklärungsmaterial für Schulen und die breitere Öffentlichkeit, um das Wissen über Erkrankungswege und Infektionsvermeidung in der Bevölkerung zu steigern.
Als One Health-Plattform bündelt CYSTINET-Afrika die grundlegende, epidemiologische, klinische, digitale und sozialwissenschaftliche Forschung sowie den Aufbau von One Health-Kapazitäten. Die Plattform stärkt den Transfer von Forschungsergebnissen in die One Health-Politik auf lokaler Ebene und ihre Integration in globale Maßnahmen der WHO.
Faktenblatt in englischer Sprache
Weitere Informationen: www.cystinet-africa.net
Facebook: @CYSTINET-Africa
LinkedIn: @CYSTINET-Africa
Instagram: @cystinet_africa
Twitter: @CYSTINET_Africa

2023-2028 (2. Förderphase)
Direktor
Dr. Mary Mwanyika Sando
Africa Academy for Public Health, Dar es Salaam, Tansania
Co-Direktor
Prof. Dr. Dr. Till Bärnighausen
Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
Partnerinstitutionen (alphabetisch nach Ländern)
Das übergreifende und langfristige Ziel des Forschungsnetzwerks DASH ist die Förderung der Gesundheit von Jugendlichen in Subsahara-Afrika durch bevölkerungsbasierte Interventions- und Politikforschung.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die effiziente Erhebung und Nutzung relevanter Daten zur Jugendgesundheit und der Einsatz robuster quantitativer und qualitativer Methoden mit lokalem, bereichsspezifischem Fachwissen in den Bereichen Ernährung und körperliche Aktivität, sexuelle und reproduktive Gesundheit sowie psychische Gesundheit und Gewalt kombiniert werden. So hofft das Netzwerk wichtige Forschungslücken in Bezug auf den Bedarf an Maßnahmen und Strategien sowie deren Gestaltung, Bewertung und Übertragbarkeit schließen zu können.
Im Erfolgsfall wird DASH durch die geplanten Forschungsaktivitäten dazu beitragen, die Forschungsinfrastruktur und die Evidenzbasis erheblich zu stärken und damit die Gesundheit von Jugendlichen in Subsahara-Afrika zu verbessern.
Faktenblatt in englischer Sprache
Weitere Informationen: https://www.dash-rhissa.org/

2023-2028 (2. Förderphase)
Direktor
Dr. Adamu Addissie
Addis Abeba University, Addis Abeba, Äthiopien
Co-Direktor
Prof. Dr. Eva J. Kantelhardt
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Deutschland
Partnerinstitutionen (alphabetisch nach Ländern)
Das Netzwerk NORA ist ein multidisziplinäres Konsortium, das aus sieben Institutionen in vier afrikanischen Ländern und Deutschland besteht. NORA will dazu beitragen, die Anzahl der an Krebs erkrankten Menschen und die krebsbedingte Sterblichkeitsrate in Subsahara-Afrika deutlich zu senken; der Schwerpunkt der Forschungsarbeiten liegt auf Brust- und Gebärmutterhalskrebs. NORA wird wissenschaftliche Erkenntnisse für wirksame Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennung, Behandlung und Pflege erarbeiten und multidisziplinäre Forschung durchführen, um die Politik über wirksame und nachhaltige Strategien zur Krebsbekämpfung zu informieren. Darüber hinaus investiert NORA in den Aufbau von individuellen Kapazitäten, die Forschungsinfrastruktur und ein Mentoring durch erfahrene Spezialisten und Spezialistinnen, um die nächste Generation afrikanischer Führungskräfte in der Krebsforschung auszubilden.
Faktenblatt in englischer Sprache
Weitere Informationen: https://www.uk-halle.de/nora
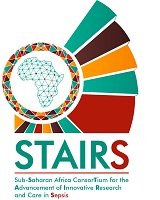
2023-2028 (2. Förderphase)
Direktor
Dr. Nathan Kenya-Mugisha
Walimu, Kampala, Uganda
Co-Direktoren
Prof. Dr. Konrad Reinhart
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland
Dr. Torsten Feldt
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland
Partnerinstitutionen (alphabetisch nach Ländern)
Sepsis ist eine lebensbedrohliche Organfunktionsstörung, die durch eine unkontrollierte Reaktion des Wirts auf eine Infektion verursacht wird. Weltweit treten jährlich 48,9 Millionen Fälle von Sepsis auf, die zu elf Millionen sepsisbedingten Todesfällen führen. Die sepsisbedingte Sterblichkeit ist in Subsahara-Afrika höher als in jeder anderen Region der Welt. Das Netzwerk STAIRS zielt darauf ab, diese unverhältnismäßige Belastung durch die Sepsis-Sterblichkeit zu verringern, indem es kritische Wissenslücken in der Epidemiologie, der Diagnose und der Qualitätsversorgung von Patienten schließt, die wegen einer Sepsis ins Krankenhaus in ressourcenbeschränkten Gebieten von Subsahara-Afrika eingewiesen werden müssen. Das Konsortium besteht aus einem Netzwerk von zehn Institutionen aus sieben afrikanischen Ländern (Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Ghana, Mosambik, Nigeria, Sierra Leone und Uganda) und Deutschland. Neben der Leitung des Konsortiums durch den Direktor unterstützen die Ko-Direktoren sowie der wissenschaftliche Leiter, Dr. Shevin Jacob (Uganda), und der stellvertretende wissenschaftliche Leiter, Dr. Tafese Tufa (Äthiopien), das Netzwerk.
Faktenblatt in englischer Sprache
Weitere Informationen: https://www.stairs-sepsis.com/

2016-2028 (1. und 2. Förderphase)
Direktor
Prof. Dr. Alexander Yaw Debrah
Kumasi Centre for Collaborative Research in Tropical Medicine, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana
Co-Direktor
Prof. Dr. Achim Hörauf
Dr. Ute Klarmann-Schulz (Nachfolge)
Universitätsklinikum Bonn, Bonn, Deutschland
Partnerinstitutionen (alphabetisch nach Ländern)
Ziel des Netzwerks TAKeOFF ist es, die Behandlung von Menschen zu verbessern, die an lymphatischer Filariose (LF) und Podokoniose erkrankt sind – Erkrankungen, die mit teils extremen Schwellungen an Gliedmaßen einhergehen. Von 2017 bis 2022 hat das Konsortium mit Forschenden aus Ghana, Tansania, Kamerun und Deutschland digitale Instrumente für eine bessere Identifizierung von Lymphödemen (LE) entwickelt und klinische Studien durchgeführt. Diese zeigten, dass ein intensives Hygienetraining für LE-Patienten die Krankheitsbeschwerden verringert und zu einer besseren Lebensqualität führt. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird sich die künftige Arbeit des Konsortiums auf folgende Schwerpunkte konzentrieren: 1) Weiterverfolgung der Patientenkohorten mit neuen Forschungsfragen in Bezug auf nicht übertragbare Krankheiten, Wunden und Antibiotikaresistenzen. Zudem sollen Zentren und Teams für das Krankheitsmanagement auf- und ausgebaut werden, um sie in nationale Kontrollprogramme/Gesundheitssysteme zu integrieren; 2) Integration der entwickelten digitalen Instrumente in nationale/internationale Gesundheitssysteme; und 3) Nutzung der für die Durchführung klinischer Studien aufgebauten Kapazitäten zur Durchführung von Test- und Behandlungsstudien für LF und die durch Fadenwürmer ausgelöste Flussblindheit (Onchozerkose).
Faktenblatt in englischer Sprache
Weitere Informationen:
https://www.microbiology-bonn.de/en
https://kccr-ghana.org/research-impact/research-groups-projects/onchocerciases-lymphatic-filariasis/
Twitter: @TakeoffNTD, @T_PodoCam

2016-2028 (1. und 2. Förderphase)
Direktor
Prof. Dr. Salome Charalambous (zuvor Prof. Dr. Gavin Churchyard)
The Aurum Institute, Johannesburg, Südafrika
Co-Direktorin
Dr. Andrea Rachow (zuvor Prof. Dr. Michael Hölscher)
Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Deutschland
Partnerinstitutionen (alphabetisch nach Ländern)
Das TB Sequel-Netzwerk ist ein Forschungskonsortium, das auf langjährigen Forschungskooperationen aufbaut. Alle Partner sind für ihre Expertise in der Tuberkuloseforschung hoch angesehen und arbeiten seit mehr als 15 Jahren erfolgreich zusammen. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 arbeitet das TB Sequel-Netzwerk daran das Wissen und die Zusammenarbeit zur Post-Tuberkulose-Lungenerkrankung (PTLD) zu erweitern. Trotz bestehender Behandlungsmöglichkeiten sind mehr als die Hälfte aller Tuberkulosekranken von Spät- und Langzeitfolgen einer TB betroffen. Die TB Sequel-Kohorte mit 1.560 neu diagnostizierten Tuberkulosepatienten und -patientinnen war das weltweit erste prospektive Forschungsprojekt dieser Größe und Dauer und schuf eine einzigartige wissenschaftliche Plattform zur umfassenden Erforschung der PTLD. Vier afrikanische Standorte verfügten über Fachkenntnissen im kardiorespiratorischen und klinischen Studienmanagement. Forschende des Netzwerks TB Sequel waren Mitorganisatoren des ersten und zweiten Internationalen Post-Tuberkulose-Symposiums und gehörten zu den führenden Autoren der ersten Veröffentlichungen in 30 Jahren, in denen die Epidemiologie der PTLD zusammengefasst und Standards für die Diagnose und das klinische Management entwickelt wurden.
Faktenblatt in englischer Sprache
Weitere Informationen: www.tbsequel.org
Twitter: @TBSequel
Europa und Subsahara-Afrika – Gemeinsam fördern und forschen
Zusammen mit Ländern in Subsahara-Afrika hat eine Gruppe europäischer Staaten im Jahr 2003 eine inzwischen sehr erfolgreiche Förderinitiative entwickelt: die „European & Developing Countries Clinical Trials Partnership“, die seit Beginn der dritten Förderrunde 2023 unter der Bezeichnung „Global Health EDCTP3“ läuft. Im Zentrum dieser vom BMBF unterstützten Förderinitiative steht die Finanzierung klinischer Studien zu Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika für den Kampf gegen Malaria, AIDS, Tuberkulose und weiteren armutsbegünstigten Krankheiten.
Ein zweiter Schwerpunkt der Förderinitiative ist der Aufbau von Forschungskapazitäten in Afrika. Dies unterstützt Global Health EDCTP3 beispielsweise durch ein vielfältiges Stipendienprogramm.
PDPs: Gemeinsam für neue Medikamente und Therapien
Ein wichtiger Baustein der BMBF-Förderstrategie für die globale Gesundheit ist die Unterstützung von Produktentwicklungspartnerschaften („Product Development Partnerships“, PDPs). Partner aus akademischen Instituten, öffentlichen Forschungseinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und forschenden Pharma-Unternehmen arbeiten dabei zusammen. Kosten und Risiken werden so auf viele Schultern verteilt. Deshalb können Produkte neu entwickelt und zu Preisen angeboten werden, die auch für die Menschen in ärmeren Ländern erschwinglich sind. Im Fokus stehen zwei Krankheitsgruppen:
PDPs der 3. Förderrunde (2023 – 2028)
Drugs for Neglected Disease initiative (DNDi)
Diese internationale PDP hat das Ziel, sichere, wirksame und erschwingliche Therapien für vernachlässigte Krankheiten bereitzustellen. Zudem unterstützt sie den Aufbau von Kapazitäten für die klinische Forschung zu endemischen Krankheiten in den betroffenen Ländern. Das Forschungsportfolio der Organisation umfasst aktuell die Schlafkrankheit, Leishmaniose, Chagas-Krankheit, Dengue, Filariosen, HIV/Aids-Infektionen bei Kindern, Hepatitis C sowie Myzetom.
European Vaccine Initiative (EVI)
EVI ist eine führende europäische und gemeinnützige PDP mit dem Ziel, die Entwicklung wirksamer und erschwinglicher Impfstoffe für die globale Gesundheit zu unterstützen und zu beschleunigen. Der Forschungsfokus liegt aktuell auf Malaria, Leishmaniose, Durchfallerkrankungen, der Nipah-Virusinfektion und der Zika-Viruserkrankung.
International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)
IAVI ist eine 1996 gegründete PDP, die Impfstoffkandidaten und Antikörper gegen HIV, Tuberkulose, neu auftretende Infektionskrankheiten und vernachlässigte Krankheiten entwickelt. IAVI bietet auch anderen Organisationen in diesem Bereich Dienstleistungen und Unterstützung im Bereich der translationalen Forschung an und hilft ihnen bei dem komplexen Prozess der Überführung von Innovationen aus dem Labor in klinische Studien.
Population Council
Population Council ist eine internationale, gemeinnützige Organisation, die bereits 1952 gegründet wurde und Forschung in den Bereichen Biomedizin, Sozialwissenschaft und öffentlicher Gesundheit betreibt. Der Fokus liegt auf der Stärkung von und der Aufklärung über reproduktive Gesundheit, Rechten und Behandlungsmöglichkeiten, sowie Gleichberechtigung der Geschlechter mit dem gleichzeitigen Aufbau von Forschungskapazitäten in ärmeren Ländern. Population Council entwickelt Mikrobizide und multifunktionelle Produkte, welche der Prävention von ungewollten Schwangerschaften, HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten dienen.
Global Alliance for TB Drug Development (TB Alliance)
TB Alliance widmet sich der Erforschung und Entwicklung besserer, schneller wirksamer und erschwinglicher Medikamente gegen Tuberkulose (TB). Gegenwärtig koordiniert TB Alliance die historisch größte TB-Medikamenten-Pipeline von über 20 Wirkstoffkandidaten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und konnte bereits mehrere Durchbrüche bei der Entwicklung von neuen Medikamenten erzielen.
Weitere Informationen zu BMBF geförderten Aktivitäten der PDPs
in deutscher Sprache: Produktentwicklungspartnerschaften
in englischer Sprache: Product Development Partnerships (PDPs)